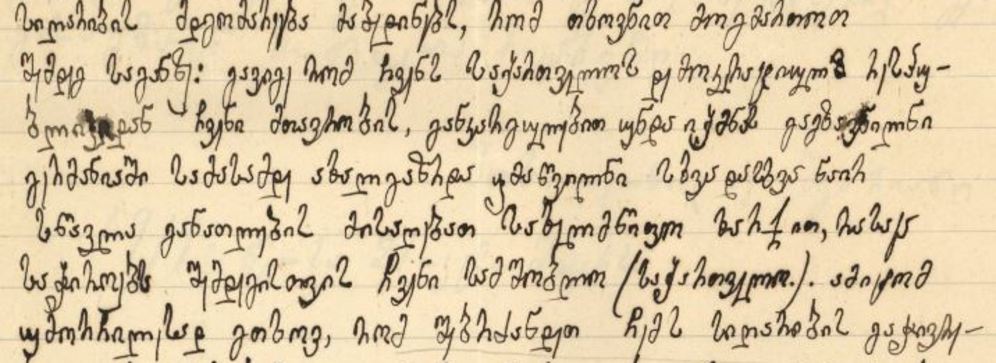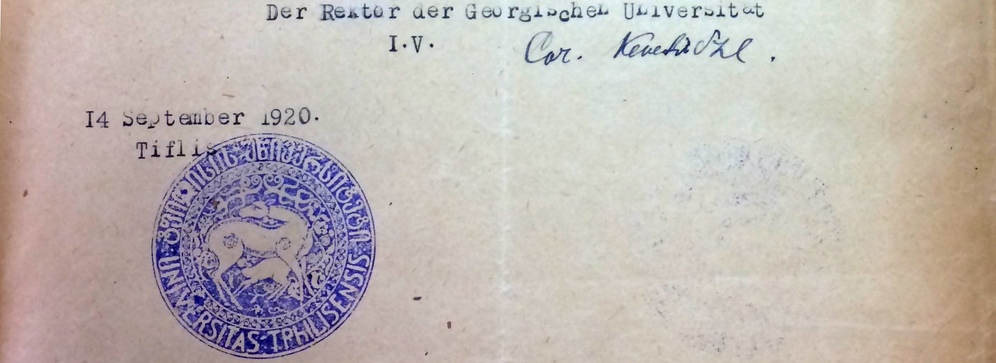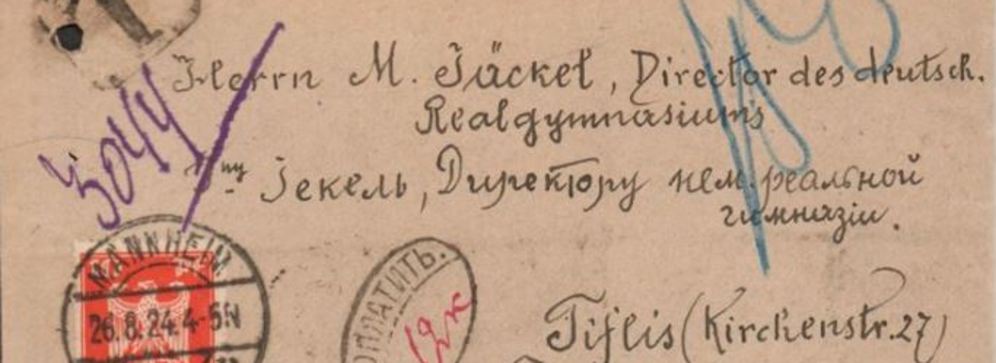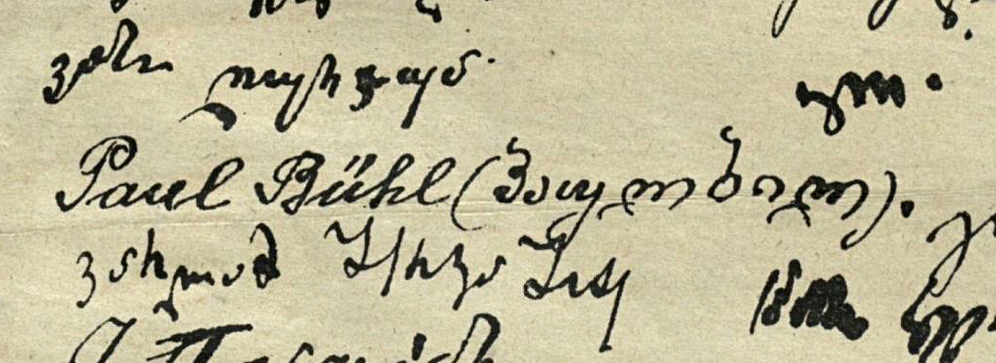Ein deutsches Dorf in Georgien: Erinnerungen an die guten und schlechten Zeiten
Auch wenn zum Thema „Deutsche im Südkaukasus“ schon seit Jahrzehnten viel geforscht und publiziert wird, gibt es noch Nachholbedarf; einige Siedlungen standen noch nie im Fokus der Forscher und sind gänzlich in Vergessenheit geraten. Das betrifft beispielsweise die Siedlung Rosental bei Muchrani (Mukhrani), jetzt Vardisubani in Georgien. Bei der Arbeit an meinem Buch über Alexandersdorf (Alexandersdorf – ein schwäbisches Dorf im Kaukasus. Die ersten 100 Jahre – Familienchronik 1817-1917. Ludwigsburg, 2017) habe ich einige ehemalige Rosentaler kennen gelernt, die Bewegendes zu erzählen hatten. So ist dieser Artikel entstanden – ein weiteres Steinchen zum bunten Mosaikbild der schwäbischen Geschichte im Südkaukasus.
Rosental ist eine den letzten deutschen Kolonien, die in Georgien vor 1941 gegründet wurden. 1817-1818 kamen Schwaben aus Württemberg in den Südkaukasus und gründeten dort ihre Siedlungen. Im Laufe der Zeit wurden fast alle Wirtschaften aufgrund des Erbrechts in Halbe- und einige in Viertelwirtschaften geteilt. Weitere Teilungen wurden später verboten, weil die Ernährung der Familien nicht gesichert werden konnte, schrieb die „Kaukasische Post“ 1909.
Wegen Landmangel gingen einige Alexandersdorfer schon ab 1908 nach Traubenberg (heute Tamarisi), ab 1925 nach Marnaul (Marneuli) und ab 1922 nach Hoffnungstal (bei Karjas). In der Sowjetzeit wurden die Kolonisten zwangskollektiviert und ihr Land verstaatlicht.
1933 bekamen ansiedlungswillige Alexandersdorfer Ländereien bei Muchrani und Karjas zugeteilt. Handwerker, die eine Beschäftigung in Tbilisi hatten, z.B. bei der Eisenbahn, blieben meist in Alexandersdorf. Mehrere Bauern und Weingärtner waren aber entschlossen, sich auf neuen Ländereien anzusiedeln. So zogen 43 Familien in die Gegend bei Karjas und gründeten das Dorf Traubental.
28 Familien aus Alexandersdorf ließen sich in der Gegend von Muchrani nieder und gründeten Rosental. Das Land für die neue Siedlung wurde 1933 zugeteilt und musste zuerst urbar gemacht werden. Die Männer mit ihren erwachsenen Söhnen fuhren aus Alexandersdorf nach Rosental, um das Land von Hecken und stacheligem Gebüsch zu befreien. (Der Name „Rosental“ kommt von den Heckenrosen, die es in der Gegend in Hülle und Fülle gab). Am Anfang wohnten die Siedler noch in Holzhütten, bis sie ihre Häuser fertig gebaut hatten. Die meisten Familien zogen 1936 nach Rosental um.
Die 95-jährige Erna Thim, geb. Gerstenlauer, und die 86-jährige Irma Bruschko, geb. Schock, sind ehemalige Rosentaler. Heute leben beide in Württemberg und erinnern sich an ihre alte Heimat Rosental:
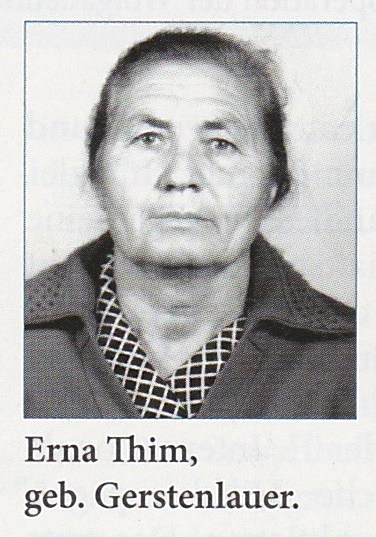
Erna Thim (wohnhaft in Mosbach, Württemberg) erzählt:
„Ich kam 1923 in Alexandersdorf bei Tiflis zur Welt. Die Siedlung Rosental wurde ca. 50 km von Tbilisi gegründet. Etwa drei Kilometer von Rosental entfernt lag auf einer Seite das georgische Dorf Muchrani (Mukhrani), auf der anderen Seite, sechs Kilometer entfernt, Krovrisi.
1934 fingen die Umsiedler aus Alexandersdorf an, in Rosental Häuser zu bauen. Meine Eltern wohnten zu der Zeit noch in Alexandersdorf. Mein Vater hatte dort eine Werkstatt; er war Wagner von Beruf und baute Transportwagen. Meine Brüder und ich mussten von Montag bis Samstag in Rosental in einer Holzhütte wohnen. Ich, damals elf Jahre alt, hatte für meine Brüder das Mittagessen zu kochen.
Meine Brüder rodeten das Land und stellten Lehmsteine (genannt „Batzen“) her, aus denen später das Haus gebaut wurde. Die „Batzen“ wurden aus zähflüssigem Lehm, gemischt mit Spreu, zu einer Art Ziegelstein geformt und in der Sonne getrocknet.
Samstags gingen wir zu den Eltern nach Alexandersdorf und montags mussten wir erneut für die ganze Woche nach Rosental. Unser Haus war kaum fertig, als die ganze Familie 1935 nach Rosental zog. Ich war da gerade 12 Jahre alt.
Auf dem Land weideten vorher die Viehherden der „Tataren“ (so nannte man damals die Einheimischenh). Dann kamen die deutschen Siedler, machten das Land urbar und pflanzten Weizen, Mais, Gerste oder Hafer an. Nicht selten kam es vor, dass die Viehherden der Einheimischen die bestellten Felder zertrampelten.
Das Dorf hatte eine Straße, 14 Häuser rechts und 14 Häuser links. Den höher gelegenen Teil des Dorfes in Richtung Ksovrisi bezeichnete man als „Oben“, der in Richtung Muchrani hieß „Unten“. Das Wasser des Bewässerungskanals lief von „Oben“ nach „Unten“. Auf der rechten Seite war das Land besser, auf der linken Seite in der Nähe zum Flusses Ksanka gab es oft Überschwemmungen.

Die Siedlung hieß Rosental, aber die Kolchose „Rosa Luxemburg“. Mein Vater Gottfried Gerstenlauer war in den Jahren 1938 bis 1941 Kolchosvorsitzender. Der Onkel Ulrich Gerstenlauer brachte die Post von Muchrani und versorgte die Dorfbewohner mit Lebensmitteln und anderen Waren. Jakob Flad war Buchhalter und half den Leuten bei verschiedenen schriftlichen Angelegenheiten.
Die ersten zwei Jahre gab es in Rosental keine Schule, später unterrichtete man die Kinder im Haus von Christian Schock; es war eine 4-Klassen-Schule. Der Lehrer, ein junger Georgier, unterrichtete auf Georgisch. Unsere Rosentaler, insbesondere die Männer, konnten gut Georgisch. Zu Hause und untereinander wurde natürlich nur Schwäbisch gesprochen.
Am 18.Oktober 1941 wurde auch unsere Familie deportiert. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir am Tag davor noch Mais ernteten und uns freuten, dass wir mit den Feldarbeiten fertig waren. Am nächsten Tag erfuhren wir, dass wir unsere Heimat verlassen mussten. Die Sachen zum Mitnehmen wurden in der Vorderstube gelagert, die Tür wurde von Milizionären abgeschlossen und versiegelt.
Am Morgen des 18. Oktobers kamen Einheimische mit „Arba“ (Fuhren). Wir mussten uns mit unseren Sachen auf die Fuhren setzen – und so ging es los ins Ungewisse. Als wir durch Muchrani fuhren, winkten uns einige einheimische Frauen weinend nach. Am Bahnhof Ksanka (Ksani) wurden wir in einen Zug Richtung Baku verladen. Dort wurden wir auf ein Schiff verfrachtet, mit dem es nachts über das Kaspische Meer nach Krasnowodsk ging und von dort weiter in Viehwaggons durch Turkmenistan und Usbekistan bis nach Kasachstan.
Am 12. November 1941 kamen wir in Pawlodar an. Nach einer Übernachtung in irgendeinem nahe gelegenen kasachischen Dorf landeten mehrere Familien schließlich in Kyzyltu, einem Dorf ca. 50 Kilometer von Pawlodar entfernt. Die anderen aus unserem Dorf kamen nach Podstepka.
Die Männer mussten schon im Februar 1942 in die Arbeitsarmee. Es war eine sehr schwere Zeit mit Hunger, Kälte und Armut – viele starben. Ich wurde als 19-Jährige im November 1942 mit anderen jungen Mädchen und Frauen ebenfalls in die Arbeitsarmee eingezogen. Auch meine vier Brüder wurden zur Zwangsarbeit mobilisiert. Erst sechs Jahre später wurde ich entlassen und kam wieder zu den Eltern nach Kyzyltu.
1959 zogen wir nach Dschetysaj, wo es wärmer war und bereits einige Kaukasusdeutsche wohnten, die sich nach Ende der Kommandanturaufsicht in Dschetysaj angesiedelt hatten.
Dort traf ich meinen Mann Ewald Thim, der aus Akstafa (einer deutschen Siedlung in Aserbaidschan) nach Kasachstan deportiert worden war. 1960 heirateten wir.
1972 besuchte ich mit meinem Vater noch einmal unser altes Heimatdorf Rosental. Es war traurig, zu sehen, in welchem Zustand unsere Häuser jetzt waren. Im Garten waren keine Bäume und keine Rebstöcke mehr. Das war nicht mehr unser schönes Rosental.
Im März 1991 kamen wir nach Deutschland.“
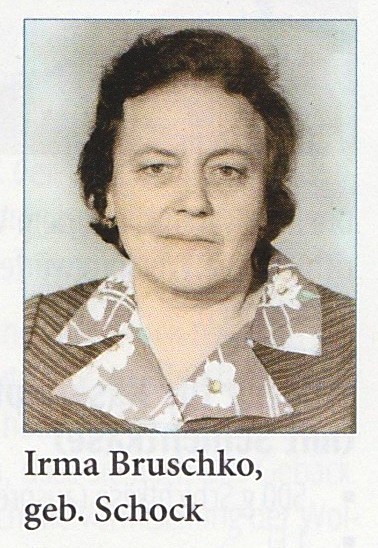
Irma Bruschko (wohnhaft in Markdorf, Württemberg), erzählt:
„Ich wurde 1932 in Alexandersdorf geboren. Mein Vater Gottlieb Schock arbeitete in Tiflis in einer Fabrik. In der Sowjetzeit wurden die Bewohner der deutschen Dörfer gezwungen, Kolchosen einzurichten. Mein Vater wurde zum ersten Vorsitzenden der Kolchose gewählt und musste den Vorsitz der Kolchose „Rosa Luxemburg“ in der Siedlung Rosental übernehmen. Zwei meiner Tanten mütterlicherseits, Paulina und Ida, sowie mein Onkel Richard väterlicherseits blieben mit ihren Familien in Alexandersdorf (damals schon zu Tbilisi gehörend) und wohnten dort bis 1941.
Als den Deutschen Ländereien für neue Siedlungen zugeteilt wurden, waren die Einheimischen („Tataren“) sehr unzufrieden. 1935 kam es zu einem furchtbaren Vorfall. Auf den bestellten Feldern wuchsen schon Weizen und Mais, trotzdem ließen die Einheimischen aus dem Nachbardorf ihr Vieh zum Weiden auf das Land. Mein Vater, als Vorsitzender zuständig für das gute Gedeihen auf den Feldern, setzte sich aufs Pferd und versuchte, die Viehherde zu vertreiben. Schnell kamen Waffen ins Spiel, die erbosten Einheimischen erschossen meinen Vater. Meine Mutter blieb allein mit zwei kleinen Kindern; ich war gerade drei Jahre und mein Bruder fünf Jahre alt.
So war der Anfang in Rosental für uns sehr schwer und traurig. Wir wohnten mit unserer Mutter, den Großeltern Ulrich Gertenlauer und Josephina (geb. Stähle) sowie unserem Onkel Robert Gerstenlauer mit seiner Familie zusammen. Meine Mutter war nach dem Tod ihres Mannes auf sich selbst gestellt und hatte auch schwere männliche Arbeit allein zu verrichten. Ich musste bereits mit fünf Jahren viel im Haushalt und mit meinem Bruder im Garten helfen.
Mein Großvater hatte mir eine kleine Gießkanne gefertigt, damit ich das Grab unseres Vaters auf dem Friedhof pflegen konnte. In Rosental gab es nur drei Gräber unserer Leute: das meines Vaters Gottlieb Schock, von Josephina Hensinger (gest. 1937) und von der Witwe Karoline Knaus (gest. 1939).
Im Oktober 1941 mussten wir Rosental auf immer Ade sagen. Das Bild, wie wir auf den Fuhren sitzend die Siedlung verlassen, habe ich immer noch vor Augen. Im Dorf entstand ein unbeschreiblicher Lärm. Es war ein ungeheuer lautes, herzzerreißendes Heulen unserer Haustiere, als wir aus dem Dorf abtransportiert wurden. Unser Hund lief noch lange unserer Fuhre hinterher, bis er nicht mehr konnte. Als mein Onkel nach dem Krieg unser Rosental besuchte, war unser Hund noch am Leben. Er erkannte den Onkel, hüpfte vor Freude wie wild herum.

Nach mehrwöchiger Reise landeten wir mit mehreren Familien aus Rosental in Kyzyltu, Kasachstan. Bereits in den ersten Kriegsjahren starben viele, darunter unser Großvater Ulrich Gerstenlauer, Jakob Klett, seine Frau Christina und ihr Adoptivsohn Jakob, Christina Leibsle, Lisa Weible, Irma Stähle und ihre Mutter Erna und noch viele andere.
Nach dem Krieg studierte ich in Pawlodar und arbeitete später 38 Jahre als Lehrerin. 1995 kam ich mit meiner Familie nach Deutschland.“
Veröffentlicht in Monatsschrift "Volk auf dem Weg", Nr. 8-9 / 2018, Seiten 44-45, Verleger und Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Stuttgart // Rubrik: Geschichte 05.12.2018
Über die Autorin:
Rita Laubhan ist 1954 in Semipalatinsk/Kasachstan geboren. Sie studierte Medizin und arbeitete als Ärztin in Semipalatinsk. Seit 1990 lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland und ist auch hier in ihrem erlernten Beruf tätig.
Genealogie (Ahnenforschung) betreibt sie als Hobby. Ihr Vater, ihre Großeltern väterlicherseits sind in Alexandersdorf/Südkaukasus geboren. Vier Generationen ihrer Vorfahren lebten in Alexandersdorf. Sie alle sind Nachkommen der Auswanderer aus Württemberg.
Publikationen:
„Zusammenhalt über fast 200 Jahren“, Deutsch-Russische Zeitung Nr.11, November 2011
„Alexandersdorf im Kaukasus – die Heimat meiner Vorfahren“, Kalender 2012, Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V., Druckerei & Verlag Steinmeier, Deiningen, 2012.
„Традиционная встреча южно-кавказских немцев в Германии“ Научно-информационный бюллетень "Российские немцы", Москва, Nr.4 (76) Октябрь-декабрь 2013
„Übersicht der deutschen Siedlungen (Kolonien) im Südkaukasus (Transkaukasien) 1817-1941“ HEIMATBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND 2017. Stuttgart 2017. Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. ISBN 978-3-923553-40-2. Seiten 108-114
„ALEXANDERSDORF – ein schwäbisches Dorf im Kaukasus. Die ersten 100 Jahre (Familienchronik 1817-1917) – Cardamina Verlag, Weißenthurm, 358 Seiten, ISBN: 978-3-86424-373-8 / Oktober 2017
Das Deutsch-Gerogische Internetarchiv dankt Frau Netsan Tataraschwili für die Zusammenarbeit.